“Kulturpolitisch muss es darum gehen, das grandiose Innovationspotenzial von KI anzuerkennen und zu fördern”
Ein Essay von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer:
Von jeher gehört es zu den Aporien der Moderne, dass technische Revolutionen nicht nur von heller Euphorie, sondern auch von apokalyptischen Diskursen begleitet werden. Düster prognostiziert man die Machtübernahme der Maschinen oder gleich den Untergang der Menschheit. Mit der Künstlichen Intelligenz verhält es sich nicht anders. Allerdings mit dem Unterschied einer massiven narzisstischen Kränkung: Zum ersten Mal, so scheint es, überholt eine technologische Innovation die Evolution des menschlichen Geistes.
Damit erleben wir die verschärfte Variante eines alten Dilemmas: die Dialektik des technischen Fortschritts. Jede neue Technologie bedeutet einen qualitativen Sprung in der Menschheitsgeschichte, macht aber auch menschliches Können, menschliche Arbeitskraft obsolet. Maschinenstürmer konnten nicht verhindern, dass die frühe industrielle Revolution das klassische Handwerk atomisierte, Automobile ließen Droschkenkutscher verschwinden, Roboter ersetzten Arbeiter am Fließband.
Doch KI stößt in neue Dimensionen vor. Selbst Berufsfelder, in denen es nicht um schiere Muskelkraft oder standardisierte Abläufe geht, sondern um genuin geistige Arbeit, werden bald überflüssig sein. Übersetzer, Drehbuchschreiber, Grafiker, selbst Schriftsteller, Komponisten und Maler sehen sich mit einer technologischen Konkurrenz konfrontiert, die mit wenigen Klicks erledigt, was bislang eine menschliche Domäne zu sein schien. Wenig verwunderlich also, dass der Basso continuo alarmierter Kassandrarufe diesmal besonders schrill ausfällt.
Und in der Tat: Keine andere Technologie hat unsere Welt derart rasant verändert wie KI. Fast wöchentlich werden neue Anwendungen erschlossen und damit transformative Techniken, die den Wert geistiger Arbeit in Frage stellen. Wenn aber das Schöpferische, das Philosophen aller Epochen als das Gottgleiche im Menschen betrachteten, kein Privileg genialischer Künstler mehr ist, sondern nur noch das Resultat besonders clever programmierter Rechner, kommt das einem Nekrolog auf das schöpferische Momentum gleich.
Sind Intelligenz und Kreativität womöglich gar keine singulär menschlichen Phänomene? Muss die Krone der Schöpfung abdanken und sich der beschämenden Tatsache stellen, dass Algorithmen klüger, komplexer, kreativer und ungleich schneller agieren als das vermeintliche Wunderwerk des menschlichen Gehirns?
Im Hinblick auf die Kreativität könnte bereits ein flüchtiger Blick in die Kunstgeschichte ein wenig Entwarnung geben. Als Louis Daguerre 1839 einer staunenden Öffentlichkeit die Daguerreotypie vorstellte, war das für viele Maler ein Schock. In der technischen Reproduzierbarkeit der Realität sahen sie wahlweise eine unfaire Konkurrenz oder gleich das Menetekel ihrer eigenen Abschaffung. „Die Fotografie ist der Todfeind der Malerei“, wütete denn auch der Dichter Baudelaire – und ließ sich wenig später im Fotoatelier portraitieren.
Ohnehin kam alles ganz anders. Aus der vermeintlich seelenlos reproduzierenden Fotografie entwickelte sich neben der Gebrauchsfotografie auch das Genre der autonomen fotografischen Kunst. Und die Malerei musste keineswegs kapitulieren. Befreit von der Aufgabe, die Realität möglichst naturgetreu abzubilden, eroberte sie sich mit Stilrichtungen wie dem Impressionismus eine nie gekannte Freiheit, ihre eigenen künstlerischen Wirklichkeiten zu erschaffen.
Eine wesentlich intelligentere Frage stellte im darauffolgenden Jahrhundert Pablo Picasso: Wer denn eigentlich das getreueste Abbild eines Gesichts erzeuge – der Maler, der Fotograf oder der Spiegel? Heute würde er ergänzen: oder ein KI-generiertes Bild?
Die Antwort ist bereits in der Frage enthalten. Fotograf und Spiegel zeigen uns Momentaufnahmen, der Maler hingegen verfährt nach dem Diktum Paul Klees: Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, Kunst macht sichtbar. Gut möglich also, dass der subjektive Blick des Künstlers wesentlich mehr sichtbar und damit bewusst macht, als jedes noch so perfekte KI-generierte Abbild.
Vor diesem Hintergrund muss keineswegs beängstigen, dass KI Videos, Bilder und Texte durch wenige Klicks erzeugen kann. Im besten Falle beschleunigt und erweitert KI die Möglichkeiten, auch die der Kreativen. Nur deren Rolle wird sich wandeln: von Schöpfern zu Kuratoren, die aus Tausenden, wenn nicht Millionen Optionen die eine herausfiltern, die mit ihrer künstlerischen Intention und ihrer ästhetischen Handschrift kompatibel ist.
Auf einem anderen Blatt stehen allerdings die Usancen des Data Mining. Zurzeit erleben wir einen beispiellosen Raubzug der KI-Giganten, die sich völlig ungeniert aus dem Fundus geistigen Eigentums rund um den Globus bedienen. Was in den Rechenzentren von Silicon Valley und Shenzhen geschieht, ist ein industriell organisierter Diebstahl. Amerikanische und chinesische Tech-Giganten trainieren ihre KI-Systeme mit Milliarden von Werken – Bildern, Texten, Musik, ganzen Bibliotheken menschlicher Schöpfungskraft – ohne auch nur einen Cent an die Urheber zu zahlen, geschweige denn, deren Einwilligung einzuholen.
Deshalb grenzt es an digitalen Kolonialismus, wenn mit Data Mining Gewinne in astronomischen Höhen erwirtschaftet wird. Vor allem Europa mit seinen kulturgeschichtlichen Schätzen wird zum bloßen Rohstofflieferanten für KI-Systeme degradiert und schamlos ausgebeutet. Dementsprechend sehen sich Kreative gleich doppelt in ihrer Existenz bedroht: zum einen, weil sie à la longue überflüssig werden könnten, zum anderen, weil sie bei der milliardenschweren Wertschöpfungskette schlicht leer ausgehen.
Dabei steht weit mehr auf dem Spiel als die wirtschaftliche Existenz einzelner Künstler. Es geht um das Fundament der modernen westlichen Kultur. Der Respekt vor geistigem Eigentum hat sich über Jahrhunderte entwickelt, als Erkenntnis, dass geistige Schöpfung einen Wert hat und geschützt werden muss. Erst in diesem Schutzraum wurden Fortschritte in Kunst und Wissenschaft möglich. Die Anerkennung von Werk und Urheber motiviert Menschen, Ideen zu entwickeln, schöpferisch zu arbeiten, Neues zu erschaffen.
Doch nun begegnen Autoren ihren Gedanken in KI-generierten Texten, Schauspieler hören ihre Stimmen in Werbespots, Musiker erkennen ihre Kompositionen geringfügig verändert in Jingles, Videospielen oder Filmmusiken. Weltweit klagen bestohlene Künstler gegen die Konzerne. Meist vergeblich.
Einiges Aufsehen erregte der Streit zwischen Schauspielerin Scarlett Johannsen und OpenAI-Gründer Sam Altman. Der hatte Johannsen um das Go gebeten, ihre Stimme für einen ChatGPT-Sprachassistenten zu verwenden. Sie verweigerte das Einverständnis, entdeckte aber wenig später ihre KI-generierte Stimme bei der Sprachoption „Sky“ – und wehrte sich öffentlich. Altman gab klein bei, entschuldigte sich und änderte Stimmfarbe und Diktion.
Solche kleinen Siege werden die Ausnahme bleiben. Auch Deepfake-Technologien sind schneller als jede Klage. Und was einmal im Netz ist, bleibt bekanntlich im Netz.
Weit dramatischer noch fallen die Konsequenzen für Unternehmen aus, die auf klassisches Web-Marketing gesetzt haben. Mittlerweile erodieren ganze Business Cases. Zeitungen und Verlage verlieren erdrutschartig Klicks, weil KI die gewünschten Inhalte bereits vor den Suchergebnissen zusammenfassend präsentiert. Die Folge sind nicht nur wegbrechende Werbeeinnahmen. Mit Gemini hat Google eine KI installiert, die darüber hinaus eine gewaltige Deutungsmacht ausübt: Allein Gemini entscheidet, was Relevanz beanspruchen darf und was nicht. Welche Interpretation aber bei der vermeintlich neutralen Faktenübersicht mitgeliefert wird, ist so wenig transparent wie die politischen und ökonomischen Implikationen, die dahinterstehen.
Bei den Kreativen hingegen tun sich auch Chancen auf. Tendenziell ereignet sich zurzeit eine Vergesellschaftung von Produktionsmitteln: Bildende Künstler brauchen kein Atelier, keine Leinwände, keine Farben mehr, Komponisten benötigen keine teuren Tonstudios für ihre Musikproduktionen, Autoren keine umfangreiche Bibliothek, um Sachbücher oder einen historischen Roman zu schreiben. Die Zugänglichkeit von KI bedeutet deshalb auch erweiterte Spielräume und neue Texturen, das wird leicht vergessen.
Der Schriftsteller Daniel Kehlmann, der ein Jahr lang – nach eigenem Bekunden erfolglos – versuchte, mit einem im Silicon Valley entwickelten Algorithmus eine Kurzgeschichte zu schreiben, bezweifelt zwar die Schöpferkraft von KI, nennt sie aber immerhin einen „Co-Autor“. Das könnte sich bald ändern. Perspektivisch wird das bereits antizipiert, etwa durch den US-amerikanischen Literaturwissenschaftler Thomas A. Bass: „Ich kann es nicht erwarten, dass unsere Maschinen erwachsen werden, um sich mehr Poesie und Humor anzueignen.“
Kulturpolitisch muss es daher zunächst darum gehen, das grandiose Innovationspotenzial von KI anzuerkennen und zu fördern. Andererseits besteht die Herausforderung darin, geistiges Eigentum, Urheberrechte und damit die Kreativen zu schützen. Eine wesentliche Voraussetzung dafür wäre radikale Transparenz: Die KI-Unternehmen müssten offenlegen, welche Daten sie in ihre Systeme einspeisen. Mit den Transparenzvorgaben der europäische KI-Verordnung wurde ein erster Versuch in diese Richtung gestartet. Ob dies aber bei global agierenden KI-Unternehmen funktionieren wird, muss bezweifelt werden.
Regulierungsträume im Hinblick auf weltweites Data Mining sind eine Illusion. Realistischer wäre da schon eine verpflichtende Abgabe – in Analogie zur Digitalabgabe, die ich im Hinblick auf Tech-Giganten wir Google initiiert habe: eine umsatzbezogene Abgabe also, die dann über einen Verteilerschlüssel den Kreativen zugutekommt.
Noch stehen wir am Anfang der Entwicklung. Aufhalten können wir sie so wenig, wie es verfehlt wäre, ihre Chancen zu ignorieren. Da ich ohnehin nicht zu Kulturpessimismus neige, halte ich es lieber mit dem japanischen Medienunternehmer Masayoshi Son: „Wenn wir KI missbrauchen, wird sie ein Risiko sein. Wenn wir sie richtig einsetzen, kann sie unser Partner sein.“ Optimismus in Zeiten des technologischen Wandels ist daher alles andere als naiv. Wir sollten wachsam bleiben, ja. Doch nur wenn wir notorisch technikfeindliche Vorurteile ablegen, können wir von Innovationen profitieren, die im besten Fall unser Leben einfacher, unsere Arbeit effizienter, unser Mind Set beweglicher machen. Und vielleicht sogar Probleme lösen, die wir jetzt noch nicht einmal erahnen. ■

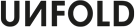

Neueste Kommentare