„Früher durften Tageszeitungen langweilig sein, das ist vorbei.“ Sagt die Medienexpertin Alexandra Borchardt. Ihr Ratschlag: lieber weniger berichten, dafür fundiert, geprüft und verständlich. Ein Gespräch über verlorenes Vertrauen, Misstrauen und Medienkompetenz
INTERVIEW: Peter Effenberg
UNFOLD: Frau Borchardt, man sagt heute immer so flapsig, der Journalismus hat sich verändert. Hat er doch eigentlich immer. Mit ihrer 25-jährigen Berufserfahrung: wo verändert er sich denn gerade jetzt?
Alexandra Borchardt: Tatsächlich ist der Journalismus immer besser geworden. Manch einer mag dem widersprechen, aber in so vielen Formaten kam der Journalismus noch nie daher. Sie können ihn heute auf verschiedensten Plattformen kons mieren, vom stundenlangen Podcast bis hin zum TikTok. Es gibt Datenjournalismus und KI-gestützten Journalismus. Investigativ-Journalisten kooperieren weltweit. Dem Journalismus als Praxis geht es also wahnsinnig gut. Allerdings sind seine Geschäftsmodelle angezählt. Und da kämpfen manche Medienhäuser sogar ums Überleben.
Wie würden Sie den Nachrichtenraum von heute beschreiben?
Früher sind die Menschen, die informiert werden wollten, zu den Medienhäusern gekommen und haben sich sozusagen die Nachrichten dort abgeholt, in der Zeitung, im Fernsehen oder Radio. Heute erwarten die Nutzer, dass die Informationen sie irgendwie finden werden. Journalismus muss den Menschen also dort begegnen, wo sie sind – üblicherweise auf dem Smartphone. Das ist für die Medienhäuser sehr anstrengend, denn sie müssen Formate für verschiedenste Plattformen produzieren.
Müssen wir uns als Gesellschaft nicht eher die Frage stellen, wie viel uns sachliche, faktische Information wirklich wert ist? Weil auch öffentliche Medien immer mehr in der Kritik stehen, als vermeintliche Staatsmedien?
Dem Vorwurf, öffentlich-rechtliche Medien seien „Staatsmedien“, möchte ich deutlich widersprechen. Sie sorgen für ein vielfältiges und unab- hängiges Informationsangebot für verschiedene Gesellschaftsschichten und tragen so zum demokratischen Diskurs bei. Internationale Studien, wie der Digital News Report des Reuters-Instituts, belegen, dass das Vertrauen in Medien dort am höchsten ist, wo es unabhängige öffentlich-rechtliche Sender gibt. Ohne sie drohen „Nachrichtenwüsten“, wie man sie teils in den USA findet. Und ja, wir müssen uns fragen, wie viel uns Journalismus wert ist. Es gibt positive Anzeichen: Menschen sind zunehmend bereit, für digitale Abonnements zu zahlen. Insbesondere jüngere Generationen haben hier eine höhere Zahlungsbereitschaft als die Älteren, die mit dem „Internet ist kostenlos“-Gedanken aufgewachsen sind. Für die im Print-Geschäft großgewordenen Verlage ist der Wandel hart; sie haben früher mit Anzeigen viel Geld verdient und trauern dem nach. Andererseits sind digitale Angebote deutlich günstiger zu produzieren, da Druckkosten und aufwendige Logistik entfallen.
Die RTL-Gruppe Deutschland hat vor einiger Zeit Gruner & Jahr gekauft und hat dann das Experiment gewagt, nicht mehr nur Bewegtbild anzubieten, sondern eben auch die Magazine aus dem Hause Gruner & Jahr. Geht so eine Strategie auf oder ist das noch zu früh?
Es ist nie zu früh, etwas auszuprobieren. Ich würde jedem Verlagshaus dazu raten, kleine zielgruppenspezifische Experimente zu wagen, daraus zu lernen und dann Erfolge zu skalieren. Menschen sind zu Erstaunlichem bereit, wenn sie davon einen Nutzen haben und wenn es sie berührt. Es heißt zum Beispiel oft, junge Leute sehen nur kurze Videos und die sind sowieso verloren für den Journalismus. Das stimmt aber nicht. Junge Leute hören dreiviertelstündige Podcasts, wenn ihnen etwas gefällt. Sie sind auch bereit, für Inhalte zu bezahlen, wenn ein Wert für sie erkennbar ist.
Wir haben über Nachrichtenräume gesprochen und dass die sozialen Medien zu diesen Nachrichtenräumen inzwischen auch dazugehören. Einerseits gehen etablierte, professionelle Medien in diese Nachrichtenräume rein, andererseits sind diese geflutet von Informationen von ganz normalen Menschen, die ihre vermeintlichen Informationen dort veröffentlichen. Dann kommen wir ganz schnell in die Vermengung von Fakten und Meinung.
Gerade für junge Nutzerinnen und Nutzer ist das ein echtes Problem. Viele beziehen ihre Nachrichten ausschließlich über Social Media. Studien zeigen, dass viele von ihnen – unabhängig von der Bildung – verunsichert sind, oft nicht mehr unterscheiden können: Was ist Journalismus? Was ist Meinung? Wer ist Influencer, wer Jour- nalist-Creator mit professionellen Standards? In dieser Vielfalt fehlt ihnen häufig die Orientierung. Das ist für Verlage eine Chance. Denken Sie an den FAZ-Wirtschaftsbericht von vor 20 Jahren – der durfte gnadenlos langweilig sein, die Interessierten lasen ihn trotzdem. Das funktioniert nicht mehr. Der Druck, interessanter, zugänglicher und präziser zu werden, tut dem Journalismus gut.
Ich habe den Eindruck, dass wir auch eine Vertrauenskrise des Journalismus haben.
Wir sitzen in Babelsberg, im Osten Deutschlands. Ich bin selbst auch aus dem Osten und das Wort „Lügenpresse“ kommt aus Dresden. Warum gibt es aus Ihrer Sicht eine Vertrauenskrise in den Journalismus und wo hat diese ihren Ursprung, falls es sie gibt?
Das ist eine klassische Glas-halb-voll-Glas-halb- leer-Frage. Schaut man in relevante Studien wie den Digital News Report des Reuters-Institutes oder die Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen, sieht man: Das Vertrauen in Medien ist in Deutschland relativ stabil. Während der Pandemie (Covid-19 Anm. d. Red.) ist es sogar leicht gestiegen, weil viele verunsichert waren und verlässliche Informationen suchten. Danach sank es wieder auf das vorherige Niveau. Der vielbeschworene Vertrauensverlust ist nicht so dramatisch, wie oft behauptet. Es gibt allerdings einen recht konstanten Anteil – etwa 20 Prozent der Bevölkerung –, der den Medien grundsätzlich misstraut. In dieser Gruppe entsteht auch der Vorwurf der „Lügenpresse“. Viele dieser Menschen haben sich eigene Informationsräume geschaffen, die mit professionellem Journalismus wenig zu tun haben. Gleichzeitig genießen öffentlich-rechtliche Medien wie ARD und ZDF weiterhin hohes Vertrauen. Deshalb würde ich die Lage nicht dramatisieren. Misstrauen gehört in einer Demokratie dazu. Wer blind vertraut, denkt nicht kritisch. Gerade Kindern und Jugendlichen wird heute beigebracht, Informa- tionen zu hinterfragen: Woher kommt etwas? Wer steckt dahinter? Ist das plausibel? Solche Fragen stärken die Medienkompetenz – und damit auch die Demokratie.
Wir müssen über das Vertrauen in Informa- tionsquellen sprechen. Wie können wir den Modellen von Google oder ChatGPT vertrauen, deren Arbeitsweise oft undurchsichtig ist und die Informationen auf eine für uns nicht nachvollziehbare Weise gewichten? Gleichzeitig haben Journalisten in aktuellen Konflikten, wie in Gaza, der Ukraine oder dem Iran, kaum noch Zugang zu den Geschehnissen vor Ort, während soziale Medien mit Material überflutet werden. Viele Videos können nicht verifiziert werden. Bietet sich da nicht eine Chance für den Journalismus? Können wir mithilfe von KI und Metadaten (Geolocation, Herkunft etc.) Material aus den sozialen Medien verifizieren, um so aus der Ferne visuell über diese Konflikte zu berichten?
Ja, da wird sich ganz viel tun. Die Zahl und Leistungsfähigkeit der Verifikationstools entwickeln sich rasant. Wichtig ist, dass Medienhäuser transparent bleiben. Viele haben klare Regeln – etwa keine mit KI generierten Nachrichtenbilder zu veröffentlichen. Man will den Menschen ermöglichen, das Gesehene einzuordnen: Was ist echt, was künstlich erzeugt? Ob sich solche Standards auf Dauer halten lassen, ist offen. Ihre Frage finde ich in diesem Zusammenhang sehr spannend – auch aus Nutzersicht. Wenn ich lese: „Wir konnten diese Informationen nicht verifizieren“, frage ich mich oft: Sollte man dann nicht lieber mit dem Bericht warten? Oft wirkt das wie ein Absichern – „Wir bringen es trotzdem, aber überneh- men keine Verantwortung.“ KI eröffnet enorme Möglichkeiten – aber nur weil etwas technisch machbar ist, heißt das nicht, dass man es tun sollte. Das betrifft nicht nur Bilder, sondern auch Themen wie Voice Cloning. Gebe ich der Stimme meiner Korrespondentin einen neuen Text? Lasse ich Verstorbene wieder sprechen? Das sind ethische Fragen, mit denen sich Redaktionen auseinandersetzen müssen. Es bringt nichts, Nutzer mit ungeprüftem Material zu überfluten. Im Zweifel lieber weniger berichten – dafür fundiert, geprüft, verständlich. Journalismus war immer Auswahl. ■

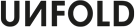

Neueste Kommentare