DAS SAGT DER MEDIENJOURNALIST CHRISTIAN MEIER:
„WO DIE WERBEEINNAHMEN FEHLEN, STIRBT DER TEURE JOURNALISMUS“
Als Mitte der 90er Jahre das Internet zum Massenmedium wurde und Medienmarken wie „Spiegel“ oder „Welt“ auch in Deutschland erste Versuche machten, digitale Nachrichten zu verbreiten, war noch nicht absehbar, wie schnell sich der Medienkonsum wandeln würde. Viele Verlage und andere Medienunternehmen unterschätzten damals die nötigen Veränderungen, wollten ihre über Jahrzehnte einträglichen Geschäftsmodelle bewahren. Das war nachvollziehbar, bremste aber nötige Investitionen in die Entwicklung einer digitalen Infrastruktur der Medien.
30 Jahre später ist das Bewusstsein für die Wucht, mit der digitale Innovationen Medienorganisationen umkrempeln, viel größer als damals. Wir ahnen nicht nur, sondern wir wissen nun, dass Medien von technologischen Revolutionen getrieben werden. Medien geben den Weg der Verbreitung ihrer Inhalte nicht vor, sondern sie müssen sich anpassen. Wenn jetzt also die Künstliche Intelligenz mit Macht erneut die Art und Weise, wie Menschen sich informieren, beeinflussen wird, wissen Medienmanagerinnen und -manager, dass sie reagieren müssen. Und zwar schnell. Fragt sich nur, wie die beeindruckenden Leistungen der KI- Modelle mit den Geschäftsmodellen von privat finanzierten Medien, die gemeinhin von Einnahmen über zahlende Abonnenten einerseits und Werbekunden andererseits leben, zum Vorteil des kapitalintensiven Journalismus nutzbar sind. Oberflächlich betrachtet: kein Problem! Medien produzieren schließlich Inhalte, dabei kann die KI unterstützen, im Idealfall kreative Arbeit anregen und ergänzen. Geht man etwas tiefer, wird ein Konflikt deutlich. Ein substantieller Anteil der bisher von Journalisten produzierten Inhalte könnte mittelfristig ersetzt werden. Hier vor allem der Anteil nicht-aktueller Beiträge, die etwa auf die Vermittlung von Nutzwert und Hintergrundinformation angelegt sind. Die Large Language Models (LLMs) von Open AI, Google Gemini und anderen Anbietern wie Meta nutzen bereits massenhaft urheberrechtlich geschützte Inhalte. Ob und zu welchen Konditionen vorher Lizenzabkommen mit Medien- unternehmen geschlossen wurden, ist sehr unterschiedlich. Wie bereits heute etwa bei der Suche mit Google zu erkennen ist, werden auf Fragen wie „Welche Kinofilme starten diese Woche?“ oder „Ist Singapur eine Demokratie?“ direkt KI-generierte Antworten geliefert. Wo Nutzer vor der KI-Integration noch auf von Google ausgegebene Links geklickt haben, müssen sie das in vielen Fällen gar nicht mehr tun. Entsprechend verlieren Medienmarken an Reichweite. Nun ließe sich sagen: Journalismus ist vor allem die Recherche, die Analyse, die Breaking News, bei der Reporter vor Ort über ein Ereignis berichten. Journalismus ist das kluge Interview, die Enthüllung bisher unveröffentlichter Dokumente, der originelle Kommentar. Das ist tatsächlich so – und das wird hoffentlich auch so bleiben. Das Problem ist nur: Werden Medien beispielsweise Werbeumsätze entzogen, weil die Reichweite wegen des gerade beschriebenen KI-Effekts sinkt, fehlt zunehmend Geld für originär recherchierten und damit teuren Journalismus.
Dazu kommt: Selbst die exklusive Nachricht wird heute bereits innerhalb sehr kurzer Zeit entwertet, wenn andere Medien die Kernbotschaften einer Recherche übernehmen. Selbst wenn sie wissen sollten, wer der eigentliche Absender hinter der Geschichte ist, wird nur ein Bruchteil der Menschen, die sich eigentlich für diese Geschichte interessieren und ein Abonnement abschließen könnten, dies jetzt noch tun. Mithilfe von KI lassen sich solche Übernahmen sogar automatisieren. Und Schnelligkeit ist in der digitalen Medienwelt ein entscheidender Faktor für die Sichtbarkeit einer Information. Werden aufwändig recherchierte Inhalte also sofort „aufgesaugt“ und in die digitalen Verwertungskanäle anderer Medien eingespeist, lohnt sich der Aufwand, originäre journalistische Inhalte zu produzieren, möglicherweise gar nicht mehr. Die Publisher weltweit haben das verstanden, in einflussreichen Magazinen wie „The Atlantic“ erscheinen Analysen mit Überschriften wie „Das Ende der Verlage, wie wir sie kannten“. Obwohl Medienprofis seit langem gesagt haben, dass Medienmarken unabhängiger von Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok werden müssen, geriet dieses Ziel in immer weitere Ferne. Nun bezeichnet der Be- griff „Google Zero“ nicht mehr das Ziel der Unabhängigkeit von der Suchmaschine, sondern den Tag, an dem kein bisschen Reichweite mehr durch die Plattformen an klassische Medien weitergereicht wird. Dazu werde es nicht kommen, beteuern etwa Google-Manager. Das ließe sich zumindest anzweifeln. Der Medienwissenschaftler Martin Andree ist davon über- zeugt, dass letztlich sogar unsere Demokratie von der KI-Revolution bedroht wird. Andree, der als Professor an der Universität Köln lehrt, prognostiziert den Sieg der Plattformen, deren Anbieter er unter dem Begriff „Dark Tech“ zusammenfasst, über die klassischen Medien. In seinem neuen Buch „Krieg der Medien“ (Campus Verlag) beschreibt er das Zusammenspiel von Tech-Milliardären wie Elon Musk, Mark Zuckerberg und Peter Thiel mit der Trump-Regierung auch als den Versuch, die Meinungsmacht zu übernehmen.
Was wird laut Andree geschehen? Zum einen kontrollieren die Plattformen bereits große Teile der Informationsverbreitung, die lineare Welt gedruckter Medien kommt an ihr Ende. Der Kontrollverlust dieser Medien über die eigenen Inhalte nimmt weiter zu. Gleichzeitig arbeiten Tech-Konzerne und Populisten, so beschreibt es Andree, an der Delegitimierung eben dieser Medienmarken, schreiben ihnen Zensur zu und inszenieren sich selbst als Kämpfer für Meinungsfreiheit. Setze Europa dieser Entwicklung, bei der KI eine verstärkende Rolle spielt, nichts entgegen, drohe die technologische und damit letztlich gesellschaftliche Kolonisierung des Kontinents. Ein düsteres Szenario. Darum wird der Journalismus um seine digitale Souveränität kämpfen müssen. ■

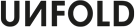

Neueste Kommentare